Schreiben ist etwas Tolles! Das wissen alle Leute, die es gerne tun. Und Rückblicke schreiben, ist ebenso großartig. In The Content Society (TCS) haben wir dafür mindestens zwei Formate, den Monatsrückblick und den Jahresrückblick. Rückblicke schreiben sich leicht, weil man im Grunde keine neuen Inhalte erdenkt, sondern „lediglich“ dokumentiert und reflektiert.
Hier auf diesem Blog schreibe ich daher auch Rückblicke. Die mögen für andere vielleicht weniger interessant sein, für mich sind sie jedoch wichtig. Zum einen zeigen sie mir, wie reichhaltig, abwechslungsreich und vielschichtig (m)ein Leben ist. Sie zeigen, mit welchen Gedanken und Themen ich mich zu einer bestimmten Zeit beschäftigte. Sie zeigen, wo Veränderungen stattgefunden haben und wie Entwick(e)lung geschieht. Rückblicke machen deutlich, für wie viele Dinge ich dankbar sein kann. Profan ausgedrückt beschreibt ein Rückblick auch einfach, wo ich stehe. Was habe ich geschafft oder umgesetzt und was möchte ich als Nächstes angehen. Ein Rückblick schafft die Basis für neues Losgehen.
Aber, wie ehrlich sind denn Rückblicke eigentlich? – Diese Frage tauchte irgendwann in meinem Space auf und ich dachte, sie zu stellen ist berechtigt. Ich fand es anregend, einmal bewusst eine andere oder gegenläufige Perspektive zu diesem Thema einzunehmen. Also recherchierte ich und wählte die interessantesten unbequemen Wahrheiten aus, um sie einmal näher zu betrachten. Es sind im Grunde 5 Aussagen, mit denen sich der Sinn oder die Berechtigung von Rückblicken infrage stellen lässt. Jeder, der diesen Beitrag liest, darf sich diese Fragen auch selbst einmal stellen. Einleitend sei gesagt, dass dieser Beitrag nicht gerade kurz ist. Man scheint 13 Minuten Lesezeit zu brauchen. Es geht um die fünf Aussagen, aber es wird thematisch auch immer mal nach links oder rechts abgebogen. Werfen wir zu Beginn einen kurzen Blick auf unsere „guten“ Gründe, Rückblicke zu schreiben.
Darum schreiben wir Rückblicke
Wenn man sich fragt, wozu wir Rückblicke schreiben, fallen uns schnell überzeugende Antworten ein:
- Rückblicke dienen als Werkzeug persönlichen Wachstums der Selbstreflexion.
- Rückblicke ermöglichen uns, einen emotionalen Abschluss zu finden, weil wir durch das Schreiben Dinge bewusst loslassen können.
- Rückblicke sortieren unsere Gedanken und verhelfen zu Klarheit.
- Rückblicke machen Muster sichtbar und klären unser Selbstbild.
- Durch Rückblicke können wir Fortschritt sichtbar machen. Wir können kleine Schritte würdigen und so unser Selbstvertrauen stärken.
- Außerdem tauchen bei einer Rückschau oft Themen und Impulse auf. Rückblicke können also kreative Quellen für neue Ideen sein.
- Rückblicke machen uns nahbar und stiften Verbindung zu unseren Lesern.
- Rückblicke können ganz praktisch auch als Schreibimpuls dienen oder als Strukturhilfe unsere Schreibroutine unterstützen.
- Rückblicke geben unserem Denken und unseren Entscheidungen Ausrichtung. Es wird sichtbar, was wirklich zählt!
So weit, so gut! Doch ALLES im Leben hat zwei Seiten. Und da wo Licht ist, ist auch Schatten. Wer sich ernsthaft mit sich selbst beschäftigt, landet früher oder später nicht nur bei erleuchtenden Erkenntnissen – sondern auch in der Abstellkammer der unbequemen Wahrheiten. Zeit, einmal hineinzuleuchten.

Fünf unbequeme Wahrheiten
1. „Rückblicke sind Selbstinszenierung – und keine Reflexion!“
Wer Rückblicke schreibt, will nicht reflektieren – sondern glänzen. Ist es Reflexion, wenn wir das letzte Jahr oder den vergangenen Monat so aufbereiten, dass es gut aussieht? Filtern wir nicht unbewusst alles, was nicht ins Bild passt? Zeigen wir, was war – oder was gesehen werden soll? Hier liefert ein psychologisches Konzept eine verblüffende Antwort.
Der Professor Dan McAdams entwickelte das Konzept der narrativen Identität. Diese beschreibt, dass Menschen ihre Identität in Form einer inneren Geschichte konstruieren. Die narrative Identität ist nicht nur eine chronologische Aneinanderreihung von Ereignissen, sondern eine sinnstiftende Interpretation.
Unsere Geschichte stiftet Identität
Für McAdams sind Geschichten wohl die natürlichste Art, sich auszudrücken, und eine wichtige psychologische Ressource. Menschen deuten ihre Erfahrungen in einer Weise, die ihnen Sinn, Bedeutung und Orientierung gibt. Die Erzählung muss in sich stimmig sein. Sie verbindet widersprüchliche oder schwierige Lebensereignisse so, dass sie als Teil eines verständlichen Ganzen erscheinen. Die narrative Identität verknüpft Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Sie hilft, eine Vorstellung davon zu entwickeln, wer man war, ist und sein möchte.
Wir können nicht kontrollieren, aber interpretieren
Man kann die Dinge, die einem im Leben geschehen, nicht völlig kontrollieren, doch hat man Einfluss darauf, wie man sie interpretiert. Die objektiven Fakten unseres Lebens sind, was sie sind. Aber in Geschichten geht es darum, wie wir Verbindungen zwischen Dingen herstellen. Und dies geschieht auf erzählende, beschreibende Weise. Jedes Leben hat Gutes und Schlechtes. Keine der beiden Versionen ist historisch genauer. Es handelt sich um narrative Interpretationen, die unterschiedliche thematische Bögen – Erlösung und Belastung – behandeln.
Sinngebung stiftet Wohlbefinden
Interessant ist, dass jedes Leben viele Anhaltspunkte bietet, die beide Schlussfolgerungen – sowohl erlösende, als auch belastende – zulassen. Und diese unterschiedlichen Arten, unser Leben zu erzählen, haben unterschiedliche Auswirkungen auf unser Wohlbefinden. Geschichten, die uns das Gefühl geben, unser Leben selbst in der Hand zu haben, sind mit einem höheren Wohlbefinden verbunden. Bei Belastungsthemen ist es genau umgekehrt.
Die Frage ist dann: Wie kann ich innerhalb dessen, was mir geschieht, meine Handlungsfähigkeit behalten? Anders ausgedrückt: Eine Geschichte sollte so konstruiert werden, dass sie für den Erzähler Sinn stiftet. Wir können vielleicht keine schöne Geschichte über das erzählen, was uns passiert ist. Aber wir können versuchen, eine bedeutungsvolle Geschichte zu erzählen. Und sinnvolle Geschichten stiften Wohlbefinden.
Aber Achtung! Es herrscht eine Erwartung in unserer Außenwelt, dass wir herausfordernde Erfahrungen in unserem Leben mit einem erlösenden Aspekt erzählen und dass wir außerdem erwarten, dass auch die anderen dazu in der Lage sind. Manchmal befinden sich Menschen aber in Situationen, die schlicht und ergreifend „Sch…e “ sind. Sie haben dann das Gefühl, weder einen Sinn darin zu erkennen, noch die richtige Geschichte zu erzählen, um sich besser zu fühlen. Dann ist es unsere Aufgabe, dies mitfühlend so stehenzulassen!
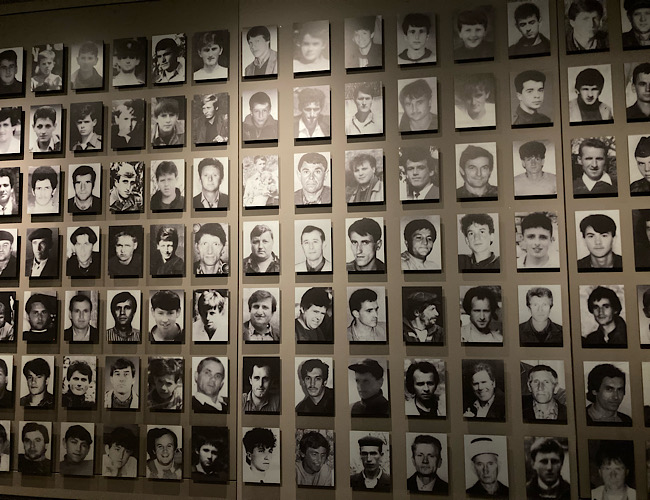
2. „Rückblicke sind Selbstgespräche, bei denen man sich selbst anlügt.“
Was erzählen wir uns im Rückblick? Und was verschweigen wir? Spitz formuliert: Wir tun so, als würden wir ehrlich zurückschauen – aber erzählen wir uns nicht vielmehr die Version, mit der wir gut leben können?
Wir schreiben keine kalten Fakten, wir erzählen unsere Geschichte. Und unser Gehirn konstruiert die Geschichte so, dass sie uns gefällt. Hier gibt es sogar Studien zu einem gut dokumentierten Konzept in der Sozialpsychologie. Es geht um den Self-Serving-Bias, eine dem Selbstwert dienliche Verzerrung. In der Psychologie bezeichnet ein Bias eine Denkverzerrung, und dieser Bias beschreibt die Tendenz von Menschen, eigene Erfolge auf innere Faktoren, wie beispielsweise persönliche Fähigkeiten oder Anstrengung, zurückzuführen. Dadurch deuten wir vergangene Ereignisse so, dass sie unser Selbstwertgefühl stützen. Und um uns zu schützen, führen wir tendenziell Misserfolge auf äußere Umstände oder Zufall zurück. Wir erfinden Ausreden, anstatt die Verantwortung zu übernehmen.
Beide Formen der selbstwertdienlichen Verzerrung können problematisch sein: Die selbstwertsteigernde Verzerrung kann zu Selbstüberschätzung führen. Die selbstschützende Verzerrung verhindert, dass wir aus unseren Fehlern lernen.
Also ja, wir erzählen uns im Rückblick die Version, mit der wir leben können. Doch selbst wenn es so ist, was wäre schlimm daran? Jeder steht an einem bestimmten Punkt seiner Biografie, seiner Entwicklung. Ein Rückblick wäre dann ein Abbild dessen, was gerade ist. Vielleicht brauche ich es gerade jetzt, zu zeigen, wie großartig ich bin? Vielleicht fühle ich mich nicht ausreichend. Vielleicht will ich nicht verurteilt oder ausgeschlossen werden. Vielleicht ertrage ich es jetzt noch nicht, in den Spiegel zu schauen. Vielleicht bin ich noch nicht so weit, mir ehrlich zu begegnen. Vielleicht weiß ich auch noch gar nicht, wie das genau geht!
Manchmal sind das die Krücken, die wir noch brauchen. Ja, manchmal lügen wir uns an und täuschen uns selbst! Ein Geschenk ist es dann, wenn wir es merken und uns fragen: Was passiert eigentlich, wenn ich’s mal nicht tue?

3. „Rückblicke sind doch Zeitverschwendung?“
Man könnte auch fragen: „Warum zurückschauen, wenn es doch das JETZT ist, das zählt?“
Selbsterkenntnis kann im Jetzt geschehen! Das Jetzt ist der einzige Augenblick, in dem wir lebendig sind. Unsere Gedanken, Gefühle und Reaktionen, die passieren im JETZT. Und wenn ich diesen Moment ganz bewusst erlebe, kann sich plötzlich Klarheit einstellen und es fällt einem wie Schuppen von den Augen. Oder – es erwischt uns ein Gespräch, ein Blick, ein Satz in einem bestimmten, kurzen Moment. Aber das ist selten. Denn meistens sind wir in unserem Geist schwer beschäftigt: Wir planen, bewerten, vergleichen, zweifeln und sorgen uns.
Selbsterkenntnis braucht dagegen einen Moment von Stille, Wachheit und manchmal auch Mut. Und sie braucht Abstand zum Problem oder zu uns selbst. Da ist ein zeitlicher Abstand, ein RückBlick, den wir auf die Situation werfen: Wir haben uns beruhigt und können anders auf die Situation schauen – vereinfacht ausgedrückt. Beruhigen, verarbeiten, reifen – das alles sind Aspekte, die eine zeitliche Dimension haben. Logischerweise können die nicht im Jetzt geschehen. Somit ist ein Bewusstsein für das, was DAVOR war, gerade das, was im JETZT zählt. Ein bewusstes Verhältnis zur Vergangenheit ist essenziell für Orientierung, Selbstverstehen und Handlungsfähigkeit in der Gegenwart.
Die Neurowissenschaft formuliert Thesen, wie: Unsere Erinnerung – das, was davor war – beeinflusst unser Selbstbild und Verhalten im Jetzt. Das Jetzt wird ständig durch das Vorher interpretiert.
Die Mindfulness-Forschung betont, dass bewusste Gegenwärtigkeit nicht bedeutet, frei von Geschichte zu sein, sondern diese reflektiert zu integrieren.
Und die Bewusstseinsphilosophie arbeitet mit der These, dass Zeitlichkeit konstitutiv für das Bewusstsein ist. Das Jetzt ist kein isolierter Moment, sondern erhält Bedeutung nur durch die Vergangenheit (Retention) und Zukunftserwartung (Protention).

4. „Nur wer scheitert, braucht Rückblicke – oder?“
Was für ein spitzer Gedanke: „Wer erfolgreich ist, schaut nach vorn. Wer feststeckt, blickt zurück.“
Ja klar ist der Satz wahr! Menschen mit hoher Zukunftsorientierung neigen dazu, zielgerichtet zu handeln, bessere Entscheidungen zu treffen und erfolgreicher im Beruf, in Beziehungen und in der Gesundheit zu sein. Stark vergangenheitsbezogenes Denken, besonders bei ruminativem, grübelndem Stil, ist mit psychischer Belastung assoziiert.
Auf den zweiten Blick drückt sich in diesem leicht gehässigen Satz noch etwas aus, nämlich die Frage: Wie stehe ich zu Fehlern, Niederlagen und Misserfolgen? Und im Grunde wissen wir alle: Fehler und Misserfolge gehören zum Leben, denn wir können aus ihnen lernen. Nur denke ich, dass das kognitive Wissen um Fehler oft nicht gegen das ankommt, was wir emotional glauben. Wir wissen, dass Fehler erlaubt sind – aber unsere Gefühle folgen oft älteren, tiefer verankerten Überzeugungen.
Bereits in der Schule werden die Kinder nicht etwa dazu eingeladen, Fehler zu machen, um Erfahrungen zu sammeln und sich auszuprobieren. Es gibt ein vorgefertigtes System, und wer dem nicht entspricht, ist falsch und wird abgestraft. Man könnte aus einer anderen Perspektive auch sagen: Eine „Fünf“ in Mathe zeigt mir als Lehrer das, was ich ihm nicht habe beibringen können. Eine „Vier“ in Geschichte fragt mich: Vielleicht war meine Stoffvermittlung für sie nicht lebendig genug? Schüler haben unterschiedliche Bedarfe, Interessen und Lebenspläne – wir müssten das gar nicht bewerten.
Misserfolge zu ernten, ist mit keinem guten Gefühl verbunden. Auf der anderen Seite sagen erfolgreiche Menschen aber, dass man keinen Erfolg haben kann, wenn man nicht bereit ist, Fehler zu machen. Fehler machen ist essenziell!
Insofern darf der Satz eigentlich lauten: „Wer erfolgreich ist, hat auf jeden Fall zurückgeblickt, sich mit seinen Fehlern bewusst auseinandergesetzt, Mut gefasst, Zuversicht gewonnen, sich neu ausgerichtet – und blickt nun nach vorn!“

5. „Rückblicke zementieren die Vergangenheit!“
Was sind das für Situationen, in denen Rückblicke einen Menschen in der Vergangenheit festhalten und dazu führen, dass Menschen sich eben nicht von Erlebtem lösen oder weiterentwickeln können? Solche Situationen können vielfältig sein.
So können Menschen, die traumatische Erfahrungen gemacht haben, innerlich in diesen Momenten „steckenbleiben“. Der Rückblick wird zur Wiederholung, nicht zur Verarbeitung.
Manche Menschen verklären vergangene Zeiten, weil sie die Gegenwart als enttäuschend oder belastend empfinden.
Was Menschen stark zurückhalten kann, ist Reue. Wenn Menschen bereuen, eine Entscheidung getroffen oder eine Gelegenheit verpasst zu haben, kann der Rückblick zur Selbstanklage werden. Sie hängen dann emotional in Gedankenspiralen oder in Grübeleien fest.
Ähnlich ist es mit unverarbeiteter Schuld: Wenn Menschen sich schuldig fühlen oder sich schämen und sich selbst nicht vergeben können, bleiben sie an die Situation gebunden. Es kann sein, dass sie diese Situationen immer wieder durchleben und sich mit ihrem Schuldgefühl tiefer und tiefer verstricken.
Eine weitere Situation kann entstehen, wenn man sein Selbstbild, seine Identität an bestimmte Ereignisse oder Lebensabschnitte gebunden hatte. Vielleicht musste man einen Beruf aufgeben, der mit großer Anerkennung und Prestige verbunden war. Dann kann das Loslassen sehr schwerfallen und einen Menschen in der Vergangenheit festhalten.
Somit kann der Blick zurück Menschen festhalten, wenn er gerade nicht zur Reflexion oder zum Lernen führt, sondern zur Verweigerung oder Flucht gegenüber der Gegenwart. Heilung und Entwicklung beginnen aber erst, wenn man lernt, die Vergangenheit anzunehmen – ohne in ihr zu verharren.

Fazit: „Rückblicke sind egozentrisch“ – und das ist auch gut so.
Drehen wir doch den Spieß um: Ja, Rückblicke sind ich-bezogen – aber genau das brauchen wir, um uns selbst zu verstehen. Wir brauchen diese Zeit der Abgrenzung vom Außen, um uns bewusst nach innen zu begeben, gerade, wenn wir unsere Quellen auffüllen oder zu neuer Inspiration finden wollen.
Und vielleicht liegt bei der Beurteilung oder Einordnung eines Rückblicks ein bisschen Selbstverantwortung auch beim Leser! Unser Wahrheitsgefühl ist wie ein inneres Organ, das wir stetig weiter ausbilden dürfen, um einen Wahrheitsgehalt empfindend zu beurteilen.
Die Bedeutung vieler Situationen im Leben entfaltet sich erst in der Rückschau. Im Rückblick erkennen wir, wofür manches gut war, wohin uns eine bestimmte Herausforderung gebracht hat oder dass sich ein Schmerz verwandelt und uns gestärkt hat. Wir sehen, wie sich bestimmte Muster wiederholen oder dass Menschen in unserem Leben gehen, andere dazukommen und einige wenige Getreue bleiben.
Ich weiß nicht, ob jeder Mensch seine Biografie rückblickend verstehen kann. Für manche ist ihr Leben Zufall. Ich denke, es ist eine Frage danach, ob man den Ereignissen seines Lebens Bedeutung geben möchte, ob man Sinn und Weisheit darin finden will. Ich möchte es jedenfalls und beschäftige mich gern damit.
Ein Rückblick zeigt nicht nur, was war – sondern, wie wir heute darauf blicken. Schau dir dieselbe Geschichte an: Was habe ich gestern dazu geschrieben, was hätte ich vielleicht vor fünf Jahren dazu gesagt und wie blicke ich in zwanzig Jahren darauf zurück? Die Frage ist, wie sehr bringe ich das andere mit ein. Schreibe und benenne ich Dinge, die nicht geklappt haben, die unperfekt sind, an denen ich gescheitert bin? Rückblicke sind manchmal kein geradliniger Blick zurück, sondern eine spiralförmige Bewegung, indem wir immer wieder zu alten Themen zurückkehren, aber auf einer neuen Ebene.
PS: Schreib mir gern im Kommentar, wenn du Gedanken oder Ergänzungen zum Thema hast!
